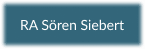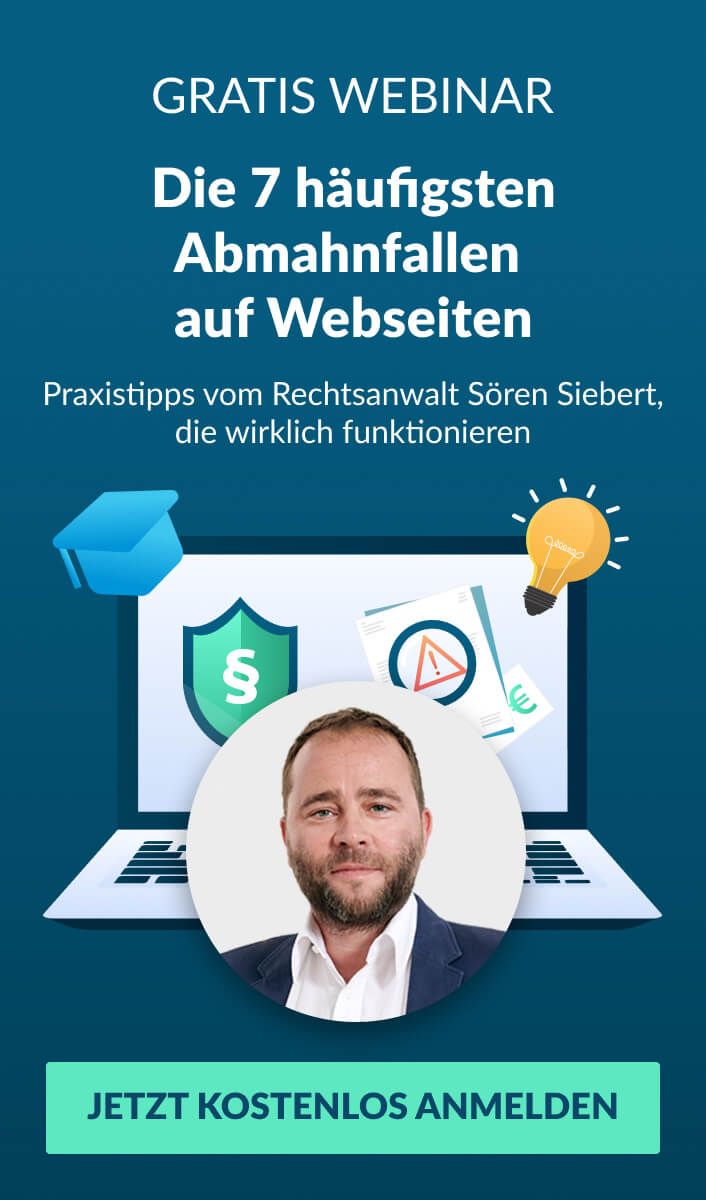Presseberichte über finanzielle Schieflage
2011 war ein Regionalverband einer bekannten Wohlfahrts-Organisation in die Schlagzeilen geraten. Der Grund: ein Defizit von knapp einer Million Euro. Nachfragen beim damaligen Geschäftsführer des Verbands waren unmöglich. Er hatte kurz vor Bekanntwerden der Probleme eine längere Reha-Maßnahme angetreten. Wer den Namen des Mannes googelt, findet bis heute entsprechende Online-Berichte. Genau das wollte der ehemalige Geschäftsführer mit seinem Gang zum Landgericht Frankfurt (Az. 2-03 O 190/16) unterbinden. Doch LG und Oberlandesgericht (Az. 16 U 193/17) wiesen seine Klage ab, ebenso wie jetzt der Bundesgerichtshof.
Abwägung von Grundrechten
Die Richter (Az. VI ZR 405/18) legten dar, dass es keinen grundsätzlichen Anspruch auf das Sperren von Inhalten gibt. Vielmehr muss in jedem Einzelfall eine umfassende Grundrechtsabwägung stattfinden. Hier zum Beispiel: die Privatsphäre des Klägers, das öffentliche Interesse der Online-Leser sowie das Recht von Google und Medien auf Anbieten von Inhalten und freie Meinungsäußerung. Im konkreten Fall hätten die Grundrechte des ehemaligen Geschäftsführers zurückzustehen hinter den Interessen von Öffentlichkeit, den Anbietern der Artikel und Suchmaschinen-Betreiber Google. Eine wichtige Rolle spielte dabei, dass die Vorgänge, über die berichtet wurde, erst neun Jahre zurücklagen.
Sonderfall: Die Frage der Wahrheit
Im nächsten Verfahren hatten zwei deutsche Unternehmer geklagt, über die 2015 auf einer US-Webseite mehrfach kritisch berichtet worden war. Die beiden verlangten die Auslistung der Artikel, weil sie angeblich nicht der Wahrheit entsprechen. Vielmehr seien sie Teil einer Erpressung: Die Betreiber der Webseite hätten angeboten, die negativen Inhalte gegen Zahlung eines Schutzgeldes wieder zu löschen. Weil also der Wahrheitsgehalt der Berichte umstritten ist, haben sich die Karlsruher Richter an den Europäischen Gerichtshof in Luxemburg gewendet. Hier soll geklärt werden, nach welchen Kriterien das Recht auf Vergessenwerden in einem solchen Fall angewendet werden kann.
Fazit
Nicht jede missliebige Berichterstattung muss unter Hinweis auf das Recht auf Vergessenwerden in den Tiefen des Internets verschwinden. Mit seinen Ausführungen hat der BGH noch einmal deutlich gemacht, dass Artikel 17 der Datenschutz-Grundverordnung nur nach sorgfältiger Betrachtung des Einzelfalls zum Sperren von Suchergebnissen führen soll.
Alles, was Sie wissen müssen