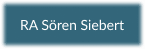Worum geht's?
Urheber und Verwerter wie Verlage oder Plattenfirmen haben sehr unterschiedliche Ausgangssituationen bei Verhandlungen. Damit die Verträge dennoch fair werden, wurde das Urhebervertragsrecht ins Leben gerufen. Das Urhebervertragsrecht stärkt die Rechte von Urhebern im Rahmen einer angemessenen Vergütung und enthält besondere Regelungen für die Kündigung von Verträgen. Alles zum Thema “Urheber und Urhebervertragsrecht” lesen Sie in diesem Artikel.
1. Was regelt das Urhebervertragsrecht?
Das Urhebervertragsrecht regelt die Rechte zwischen Ihnen als Urheber und Ihrem Vertragspartner, dem Verwerter. Dabei umfasst das Urhebervertragsrecht sowohl wirtschaftliche als auch persönliche Elemente. Das Urheberrecht selbst ist nicht übertragbar.
Viele Urheber sind allerdings bei der Verwertung Ihrer Werke auf die Hilfe von Dritten angewiesen. So brauchen z. B. Schriftsteller oftmals einen Verlag, der ihr Buch veröffentlicht. Das Verwertungsrecht an sich können Sie als Urheber nicht übertragen, Sie können jedoch Nutzungsrechte in Form einer Lizenz einräumen.
Fotografen können beispielsweise bestimmen, zu welchen Zwecken ihre Bilder oder Fotos genutzt werden dürfen. Der oben genannte Schriftsteller räumt dem Verlag das Recht ein, sein Buch zu vervielfältigen und es zu verkaufen.
Für diese Nutzungsrechte zahlt der Verwerter eine vertraglich vereinbarte Summe. Die Höhe dieser Summe orientiert sich ebenfalls am Urhebervertragsrecht, welches zuletzt 2021 angepasst wurde und sich in §§ 31 ff. Urheberrechtsgesetz (UrhG) wiederfindet.
LESEEMPFEHLUNG
Was genau Nutzungsrechte sind, welche es gibt und weitere Informationen zu diesem Thema lesen Sie in unserem Artikel “Bilder, Logos, Grafiken: So können Sie als Urheber Nutzungsrechte per Lizenz beschränken”.
2. Vergütungsregeln im Urhebervertragsrecht
Als Urheber haben Sie häufig weniger Verhandlungs- und Branchenerfahrung
als eine Verwertungsgesellschaft. Das Urhebervertragsrecht versucht dem mit einigen Regelungen entgegenzuwirken.
Beispielsweise ist in § 31a des UrhG geregelt, wie Verträge über unbekannte Nutzungsarten aussehen müssen. Eine unbekannte Nutzungsart lag zum Beispiel vor, als Zeitungsartikel plötzlich nicht mehr nur analog, sondern auch im Internet veröffentlicht werden konnten. Wenn der Vertragspartner die neue Nutzungsart nutzen möchte, wird dem Urheber ein Widerrufsrecht von drei Monaten gewährt, in denen er den Vertrag ohne eine Angabe von Gründen widerrufen kann.
Diese Widerrufsfrist entfällt, wenn sich beide Parteien nach Bekanntwerden der Nutzungsart auf eine Vergütung nach § 32c UrhG geeinigt haben oder die Vergütung nach einer gemeinsamen Vergütungsregel der Parteien getroffen wurde. Dieses Gesetz soll Sie als Urheber vor unrechtmäßig zu geringen finanziellen Vergütungen schützen.
WUSSTEN SIE’S SCHON?
Sie haben als Urheber Anspruch auf eine angemessene Vergütung nach § 32 UrhG. Selbst wenn die Vergütung im abgeschlossenen Verwertungsvertrag zwischen Ihnen und dem Verwerter bereits geschlossen wurde, diese aber als unangemessen betrachtet wird, haben Sie einen Anspruch auf eine Vertragsanpassung.
Aber wann ist eine Vergütung angemessen? Als Grundlage dafür dienen tariflich festgelegte gemeinsame Vergütungsregeln, die zwischen Urhebern und Verwertern ausgehandelt werden. Teilweise müssen Gerichte im Einzelfall entscheiden, ob eine Vergütung angemessen ist oder nicht.
3. Der Beteiligungsgrundsatz des Urheberrechts
Natürlich liegt das Risiko für den Verkauf eines Buches, vor allem eines bislang unbekannten Autors, vor allem bei der Verwertungsgesellschaft bzw. dem Verlag. Aber wie verhält sich dies, wenn sich ein Werk überraschend gut verkauft und die Vergütung relativ niedrig angesetzt wurde?
Hier greift der Beteiligungsgrundsatz. Dieser besagt, dass die Vergütung im Verhältnis zu den Erträgen stehen muss. Selbst nach einem Vertragsschluss haben Sie als Urheber in einem solchen Fall nach § 32a UrhG rückwirkend einen Anspruch auf eine Vertragsanpassung und somit auf eine angemessene Beteiligung am Gewinn. Verwerter müssen sich demnach darauf einstellen, dass Urheber auch noch Jahre nach einem großen Erfolg Ansprüche geltend machen können.
Für einen Anspruch muss die Vergütung unverhältnismäßig niedrig im Vergleich zu den Erträgen sein. Wenn Sie als Urheber zum Beispiel 100 Euro bekommen haben, aber 200 Euro angemessen wären, liegt eine Unverhältnismäßigkeit vor. Wichtig ist: Es handelt sich immer um Einzelfallentscheidungen.
4. Besondere Regelungen zum Vertragsschluss
Um die Nutzungsrechte an Werken einzuräumen, bedarf es eines Verwertungsvertrags. Grundsätzlich kann das Nutzungsrecht in Bezug auf Raum, Zeit und Inhalt frei gestaltet werden. Der tatsächliche Umfang ergibt sich aus dem Verwertungsvertrag zwischen Urheber und Verwerter. Wichtig ist hierbei die Zweckübertragungstheorie (§ 31 UrhG): Der Vertrag wird so ausgelegt, dass der Urheber im Zweifel nur die Nutzungsrechte übertragen hat, die für die konkrete Verwendung des Werkes erforderlich sind.
Beispiel: Der Umfang des Nutzungsrechts eines Buches kann sich ausschließlich auf die Veröffentlichung und den Verkauf des Werkes beziehen. Sofern nicht explizit im Verwertungsvertrag benannt, schließt dies etwaige Filmrechte an dem Werk aus.
5. Besondere Regelungen zur Vertragsbeendigung
Neben den üblichen Vertragsbeendigungen wie ordentliche und außerordentliche Kündigung, Kündigung aus wichtigem Grund, Vertragsauflösung, zeitlichen Ablauf durch einen befristeten Vertrag oder eine auflösende Bedingung oder einer Aufhebung, sieht das Urhebervertragsrecht Besonderheiten vor.
Damit Sie als Urheber Ihrem Vertragspartner in nichts nachstehen, gelten folgende besonderen Rechte für die Beendigung des Vertrags:
- Widerrufsrecht für unbekannte Nutzungsarten nach § 31a UrhG
- Rückrufsrecht bei Unternehmensgesamtveräußerung bzw. Änderung der Beteiligungsverhältnisse nach § 34 Abs. 3 Satz 2 und 3 UrhG
- Kündigung bei Verträgen über künftige Werke nach § 40 Abs. 1 Satz 2 UrhG
- Rückrufsrecht wegen Nichtausübung nach § 41 UrhG
- Rückrufsrecht wegen gewandelter Überzeugung nach § 42 UrhG
WUSSTEN SIE’S SCHON?
Beenden Sie als Urheber einen Vertrag, fallen die dem Vertragspartner eingeräumten Nutzungs- und Verwertungsrechte an Sie zurück. Haben Sie beispielsweise einen Vertrag zur Veröffentlichung Ihres Buches mit einem Verlag abgeschlossen, beenden diesen aber, darf der Verlag das Buch nicht (mehr) veröffentlichen.
6. Fazit
Das Urhebervertragsrecht dient vor allem dazu, Ihre Rechte als Urheber zu stärken. Im Urhebervertragsrecht wird die Verwertung von Werken, die urheberrechtlich geschützt sind, reglementiert.
Durch das UrhG können in den Beziehungen zwischen Urheber und seinen Vertragspartnern im Rahmen eines Vertrags einzelne Nutzungs- und Verwertungsrechte eingeräumt werden.
Damit Verwerter durch ihre jahrelange Erfahrung und Expertise nicht am längeren Hebel sitzen, können Sie als Urheber einen Vertrag unter besonderen Umständen kündigen, haben ein längeres Widerrufsrecht und einen Anspruch auf eine angemessene Vergütung.
7. FAQ zum Urhebervertragsrecht
- Zurück zur Übersicht: "Urheberrecht"
- Urheberrechtsgesetz
- Urheberrechtsreform
- EU-Leistungsschutzrecht
Alles, was Sie wissen müssen