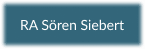Worum geht's?
Datenschutz ist für Unternehmer nicht nur eine gesetzliche Pflicht, sondern auch eine tagtägliche Herausforderung. Besonders bei der Verarbeitung sensibler oder umfangreicher Daten kann eine Datenschutzfolgenabschätzung (DSFA) erforderlich sein, um Risiken frühzeitig zu erkennen und zu minimieren. Doch wann genau ist eine DSFA nötig, wie wird sie durchgeführt und wer kann dabei unterstützen? In diesem Artikel finden Sie Antworten auf Ihre Fragen und praxisnahe Tipps zur Umsetzung.
1. Datenschutzfolgenabschätzung: Was genau ist das?
Die Datenschutzfolgenabschätzung (kurz: DSFA) wurde 2018 mit der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) eingeführt. Zentrales Element ist stets die Verarbeitung personenbezogener Daten. Daten sind dann personenbezogen, wenn sie Rückschlüsse auf eine Person zulassen und die Person durch diese Daten identifiziert werden kann.
Beispiele für personenbezogene Daten sind E-Mail-Adresse, Alter, Krankenversicherungsnummer und Geschlecht.
Eine Datenverarbeitung liegt u.a. vor, wenn Daten übermittelt, erfasst, gespeichert oder gelöscht werden. Je nach Art der Verarbeitung kann ein unterschiedlich hohes Risiko für die Daten von Betroffenen bestehen.
Ein Beispiel ist die Anmeldung zu einem Newsletter. Sie erhalten personenbezogene Daten von dem zukünftigen Empfänger in Form einer E-Mail-Adresse.
Nun kommt die Datenschutzfolgenabschätzung ins Spiel: Besteht voraussichtlich ein hohes Risiko für Rechte und Freiheiten natürlicher Personen, soll der Verantwortliche vorab die Folgen durch den Datenverarbeitungsvorgang abschätzen.
Die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) legt folglich einen risikobasierten Ansatz zu Grunde.
SCHON GEWUSST?
Verantwortlicher ist derjenige, der über die Verarbeitung personenbezogener Daten entscheidet. Das kann eine natürliche Person, ein Unternehmen, eine Behörde oder eine Einrichtung sein.
2. Wer muss eine DSFA durchführen lassen und woher kommt die Pflicht?
Gesetzliche Grundlage für die Pflicht
Die Datenschutz-Folgenabschätzung ist in Artikel 35 DSGVO geregelt. In Artikel 35 Absatz 1 DS-GVO wird zunächst auf die Form der Verarbeitung abgestellt. Birgt eine Form der Verarbeitung, insbesondere bei Verwendung neuer Technologien, aufgrund der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung voraussichtlich ein hohes Risiko in sich, ist eine Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA) notwendig.
Zuständig für die Beschreibung und Bewertung der von den Verarbeitungsvorgängen ausgehenden Risiken ist der Verantwortliche. Wurde im Betrieb ein Datenschutzbeauftragter benannt, soll sein Rat eingeholt werden.
Wer ist betroffen?
Verantwortliche können Unternehmen und Webseitenbetreiber, Behörden und öffentliche Stellen sowie Organisationen und Vereine sein. Hier kommt es auf die Form der Verarbeitung an, ob aus dieser ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen resultiert.
BEISPIELE AUS DER PRAXIS
Eine Plattform, die große Mengen an Nutzerdaten analysiert und verarbeitet, ist zur Durchführung einer DSFA verpflichtet.
Gleiches gilt für den Kundensupport mittels künstlicher Intelligenz, bei dem personenbezogene Daten von Kunden verarbeitet werden.
Wann muss eine Datenschutzfolgenabschätzung durchgeführt werden?
Haben Sie schon einmal von einer Positivliste, auch Muss-Liste genannt, gehört? Nach Art. 35 Abs. 4 DSGVO erstellen die Datenschutzaufsichtsbehörden der Bundesländer Listen von Datenverarbeitungsvorgängen, für die Datenschutz-Folgenabschätzungen notwendig sind. Diese können je nach Bundesland variieren und aktualisiert werden. Rufen Sie daher das für Sie notwendige Dokument direkt bei Ihrer Aufsichtsbehörde ab.
AUFGEPASST
Neben den Landeslisten gilt die Liste der Datenschutzkonferenz als Mindeststandard bundesweit einheitlich. Die Landeslisten können zusätzliche Verarbeitungstätigkeiten enthalten und strenger sein.
Die Datenschutzkonferenz ist ein Gremium der unabhängigen deutschen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder und tagt zweimal jährlich. Da die Liste der DSK als Mindeststandard gilt, dürfen die Landeslisten keinesfalls weniger streng ausfallen.
PRAXIS-TIPP
Prüfen Sie daher die Liste der DSK und die Liste Ihres Bundeslandes. Wird eine Verarbeitung auf Ihrer Landesliste aufgeführt, aber nicht in der Liste der DSK, sind Sie trotzdem zur Durchführung der DSFA verpflichtet.
Aufgepasst: Die Positivliste wird auch als “Blacklist” bezeichnet. Neben den Positivlisten, zu deren Erstellung die Behörden verpflichtet sind, können nach Art. 35 Abs. 5 DSGVO sogenannte Negativ-Listen erstellt werden. Diese führen Verarbeitungsvorgänge auf, für die explizit keine Datenschutz-Folgenabschätzungen durchzuführen sind.
Wird Ihr Verarbeitungsvorgang auf keiner Liste aufgeführt, bedeutet dies nicht, dass keine DSFA durchzuführen ist. Denn: Die Listen sind nicht abschließend.
In Artikel 35 Absatz 3 Datenschutz-Grundverordnung werden Regelbeispiele aufgeführt, bei deren Vorliegen zwingend eine DSFA durchgeführt werden muss:
- systematische und umfassende Bewertung persönlicher Aspekte natürlicher Personen, die sich auf automatisierte Verarbeitung einschließlich Profiling gründet und die ihrerseits als Grundlage für Entscheidungen dient, die Rechtswirkung gegenüber natürlichen Personen entfalten oder diese in ähnlich erheblicher Weise beeinträchtigen;
- umfangreiche Verarbeitung besonderer Kategorien von personenbezogenen Daten gemäß Artikel 9 Absatz 1 Datenschutzgrundverordnung oder von personenbezogenen Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten gemäß Artikel 10 Datenschutz Grundverordnung oder
- systematische umfangreiche Überwachung öffentlich zugänglicher Bereiche.
Ist Ihr Verarbeitungsvorgang von keinem der Regelbeispiele erfasst, ist zu prüfen, ob voraussichtlich ein hohes Risiko für Rechte und Freiheiten natürlicher Personen nach Art. 35 Abs. 1 DS-GVO besteht. Um das Risiko zu bestimmen, kann der Verantwortliche die Leitlinien WP 248 der Artikel-29-Datenschutzgruppe heranziehen.
SCHON GEWUSST?
Die Artikel-29-Datenschutzgruppe war ein unabhängiges Beratungsgremium der Europäischen Kommission, welches durch den Europäischen Datenschutzausschuss (EDSA) ersetzt wurde.
Die Leitlinien enthalten Risikokriterien. Liegen zwei Kriterien vor, muss der Verantwortliche davon ausgehen, dass für die jeweilige Datenverarbeitung eine DSFA notwendig ist. Aber auch schon bei Vorliegen eines Kriteriums kann eine DSFA notwendig sein. DerVerantwortliche muss seine Entscheidung begründen und dokumentieren, warum er keine DSFA durchführt.
Aufgepasst: Hilfreich ist an dieser Stelle das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten. Als Verantwortlicher sind Sie nach Art. 30 Abs. 1 DSGVO zur Führung des Verzeichnisses verpflichtet. Das Verzeichnis ist jedoch mehr als eine Pflicht, denn es hilft Ihnen dabei, den Überblick zu behalten und für jede Datenverarbeitung eine Risikoeinschätzung vorzunehmen.
Mit unserem eRecht24 Datenschutz-Management-System helfen wir Ihnen, ein Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten zu erstellen.
3. Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Datenschutzfolgenabschätzung
Zunächst einmal ist wichtig, dass die Datenschutzfolgenabschätzung vor Einsatz der jeweiligen Verarbeitungstätigkeit durchzuführen ist und nicht erst im Anschluss. Wollen Sie mehrere ähnliche Verarbeitungsvorgänge mit einem ähnlich hohen Risiko vornehmen, können Sie die Abschätzung auch gemeinsam vornehmen.
- Prüfen Sie, ob Ihr Verarbeitungsvorgang auf der Positivliste (Muss-Liste) Ihres Bundeslandes oder auf der Liste der DSK aufgeführt wird,
- Wird die Verarbeitung auf keiner Liste aufgeführt, dann prüfen Sie die Regelbeispiele aus Art. 35 Abs. 3 DSGVO,
- liegt kein Regelbeispiel vor, prüfen Sie, ob voraussichtlich ein hohes Risiko nach Art. 35 Abs. 1 DSGVO gegeben ist,
- liegt voraussichtlich kein hohes Risiko vor, dokumentieren Sie Ihre Einschätzung,
- kommen Sie zu dem Ergebnis, dass eine DSFA notwendig ist, lesen Sie weiter.
ACHTUNG
Die Abschätzung, ob von einer Datenverarbeitung voraussichtlich ein hohes Risiko ausgeht oder nicht, trifft keine Aussage, ob eine Verarbeitung grundsätzlich zulässig ist und auf welche Rechtsgrundlage sie gestützt werden kann. Nur weil Verarbeitungsvorgänge auf der Muss-Liste stehen, bedeutet dies nicht, dass sie verboten sind.
Ablauf einer DSFA
Ein Blick in die DSGVO verrät, welche Punkte innerhalb der DSFA abgearbeitet werden müssen. Gemäß Art. 35 Abs. 7 DSGVO sind folgende Schritte notwendig:
- eine systematische Beschreibung der geplanten Verarbeitungsvorgänge und der Zwecke der Verarbeitung, gegebenenfalls einschließlich der von dem Verantwortlichen verfolgten berechtigten Interessen;
- eine Bewertung der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit der Verarbeitungsvorgänge in Bezug auf den Zweck;
- eine Bewertung der Risiken für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen gemäß Art. 35 Abs. 1 und
- die zur Bewältigung der Risiken geplanten Abhilfemaßnahmen, einschließlich Garantien, Sicherheitsvorkehrungen und Verfahren, durch die der Schutz personenbezogener Daten sichergestellt und der Nachweis dafür erbracht wird, dass diese Verordnung eingehalten wird, wobei den Rechten und berechtigten Interessen der betroffenen Personen und sonstiger Betroffener Rechnung getragen wird.
Denken Sie außerdem daran, den Datenschutzbeauftragten einzubeziehen und anzuhören. Seine Stellungnahme sollte dokumentiert werden. Denn nur so können Sie im Fall einer Überprüfung Ihrer Rechenschaftspflicht gemäß Art. 5 Abs. 2 DSGVO gerecht werden.
Bei der Durchführung der DSFA kann Sie zudem das von den Datenschutzaufsichtsbehörden entwickelte Standard-Datenschutzmodell unterstützen. Es basiert auf sieben Schutzzielen und hilft bei der Risikoanalyse.
Je nach Ergebnis Ihrer DSFA kann zudem eine Konsultation der Aufsichtsbehörde nach Art. 36 DSGVO notwendig sein.
Um Ihren Rechenschaftspflichten nach der DSGVO nachzukommen, bietet sich ein Datenschutzmanagementsystem an. Mit diesem können Sie Ihr Unternehmen rechtssicher aufstellen und erkennen Schwachstellen auf einen Blick.
4. Unterstützung bei der DSFA: Wer kann Ihnen bei der Umsetzung helfen?
Auch wenn Sie als Verantwortlicher dafür sorgen müssen, dass eine Datenschutzfolgenabschätzung durchgeführt wird, können Sie sich interne oder externe Hilfe hinzuziehen. Es ist kein Problem, wenn die DSFA durch eine andere Person durchgeführt wird.
Wichtig ist jedoch, dass sie den Datenschutzbeauftragten hinzuziehen, insofern einer benannt wurde.
Sie möchten einen externen Datenschutzbeauftragten bestellen oder benötigen Unterstützung bei der Erstellung von Datenschutzkonzepten und Datenschutz-Folgenabschätzungen?
Unser Partner Legaltrust hilft Ihnen sich rechtlich abzusichern.
5. Welche Folgen drohen, wenn Sie der Verpflichtung zur Durchführung einer DSFA nicht nachkommen?
Die Nichtdurchführung einer DSFA trotz Verpflichtung kann ernsthafte rechtliche und wirtschaftliche Konsequenzen mit sich bringen.
Sind Sie zur Durchführung eines DSFA verpflichtet, weil der Vorgang auf der Muss-Liste aufgeführt wird, eines der Regelbeispiele greift oder Sie anhand der Liste der Artikel-29-Datenschutzgruppe zu dem Schluss kommen, dass die Datenverarbeitung voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen in sich birgt, sollten Sie dieser Vorgabe auch nachkommen.
Denn bei Verstößen gegen Art. 35 Abs. 1 DSGVO kann die zuständige Aufsichtsbehörde gemäß Art. 58 Abs. 2 DS-GVO Maßnahmen ergreifen. So kann gemäß Art. 83 Abs. 4 DS-GVO eine Geldbuße verhängt werden. Je nach Schwere des Verstoßes kann das Bußgeld bis zu 10 Millionen Euro oder bis zu 2 % des weltweiten Jahresumsatzes betragen.
Weiterhin kann die Aufsichtsbehörde die weitere Datenverarbeitung untersagen, verarbeitete Daten löschen lassen und verlangen, dass die DSFA nachgeholt wird. Zudem können Beschwerden von Betroffenen sowie Schadensersatzansprüche die Folge sein.
Hinzukommen Reputationsschäden und Vertrauensverlust, denn eine nicht durchgeführte DSFA wirkt unprofessionell.
6. FAQ
- Zurück zur Übersicht: "Datenschutz"
- Welche Unternehmen brauchen einen Datenschutzbeauftragten?
- Wann macht ein externer Datenschutzbeauftragter Sinn?
- Datenschutz im Homeoffice
- Standardvertragsklauseln
- Datenschutzerklärung einbinden
- Datenschutz-Audit für Unternehmen
- Datenschutz bei Software as a Service (SaaS)
- Haftung bei Verstößen gegen das Datenschutzrecht
- Datenschutz beim Recruiting
- Datenschutz für ausgeschiedene Mitarbeiter
- Datenschutz bei Kundendaten
- Weitergabe von Kundendaten an Dritte
- Datenschutz beim Gewinnspiel
- Ist ein CDN DSGVO-konform?
- Datenschutzschulung für Mitarbeiter
Alles, was Sie wissen müssen