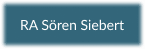Worum geht's?
Das Internet bietet unbegrenzte Möglichkeiten - auch für Studierende. Eine schier endlose Informationsquelle für Seminararbeiten. Mithilfe von KI können nicht nur Textabschnitte, sondern ganze wissenschaftliche Texte geschrieben werden. Agenturen bieten für Abschlussarbeiten Ghostwriter an. Aber was ist erlaubt und was verboten? Wann liegt ein Plagiat vor? Wann begehe ich eine Urheberrechtsverletzung? Mehr dazu erfahren Sie in diesem Artikel.
1. Unterliegt eine wissenschaftliche Arbeit dem Urheberrecht?
Generell ist es so, dass jeder Autor nach dem Urheberrechtsgesetz (UrhG) für seine Werke einen nicht unerheblichen Schutz genießt. Ein Werk liegt immer dann vor, wenn es sich um eine persönlich-geistige Schöpfung handelt. Diese ist gegeben, wenn eine logische Verbindung zwischen Inhalt und Form, die besondere Auswahl und Zusammenstellung eines wissenschaftlichen Stoffes und insbesondere die individuelle Prägung zu erkennen ist.
Dann steht dem Urheber laut Gesetz die absolute Kontrolle über Art, Umfang und Inhalt der Werkverwertung zu. Für Vervielfältigungen und Verbreitungen muss im Vorfeld seine Zustimmung eingeholt werden.
WUSSTEN SIE’S SCHON?
Auch Abschluss- und Seminararbeiten sind urheberrechtlich geschützte Werke. Das Urheberrecht an den wissenschaftlichen Arbeiten obliegt dem Studierenden, der die Arbeit verfasst hat. Ohne Zustimmung darf die Arbeit von Dritten nicht verwendet werden. Bei mehreren Verfassern einer Seminararbeit liegt eine sogenannte Miturheberschaft nach § 7 UrhG vor. Die Urheberrechte können dann nur gemeinsam ausgeübt werden.
2. Was gilt für das Urheberrecht in der Wissenschaft?
Mitarbeiter in der Lehre, die Werke zu Zwecken der Bildung vervielfältigen wollen, können dies tun. Laut Urheberrecht ist es ihnen erlaubt, 15 Prozent eines urheberrechtlich geschützten Werks zu Lehrzwecken zu nutzen.
Vollständig genutzt werden dürfen wissenschaftliche Zeitschriftenartikel, Werke mit geringem Umfang oder vergriffene Werke. Musiknoten und Live-Konzerte sowie Filme zählen allerdings zu den urheberrechtlich geschützten Werken, die auch zu Lehrzwecken einer Einwilligung des Urhebers bedürfen.
Für Forschende gelten nochmal andere Regelungen. Beispielsweise dürfen Sie laut § 60c Abs. 2 UrhG bis zu 75 Prozent eines Werkes vervielfältigen. Im Rahmen der Lehre gelten auch in der Forschung die üblichen 15 Prozent eines Werkes.
INTERESSANT
Forschungsergebnisse genießen Urheberrechtsschutz. Denn bei Forschungsergebnissen liegt die nötige Eigentümlichkeit, Originalität und Individualität vor, die ein urheberrechtlich geschütztes Werk aufweisen muss.
3. Darf ich urheberrechtlich geschützte Inhalte wie Bilder in meiner Hausarbeit verwenden?
Im Rahmen des Unterrichts und der Lehre dürfen Bilder, genauso wie Texte, genutzt werden. Auf Unterrichtsmaterialien oder in Präsentationen dürfen sie also verwendet werden. Als Werke mit geringem Umfang dürfen Bilder, Fotos und Grafiken sogar vollständig genutzt werden.
Für Seminararbeiten oder die Abschlussarbeit greifen § 60a UrhG und § 51 UrhG, die eine erlaubnisfreie Nutzung im Rahmen der wissenschaftlichen Arbeit gestatten. Genauso wie für fremde Texte gilt aber auch hier: Quellenangaben nicht vergessen!
LESEEMPFEHLUNG
Weiterführende Informationen über Bildrechte im Rahmen der Creative Commons Lizenz lesen Sie in unserem Artikel “Creative Commons Lizenz: Worauf müssen Unternehmen achten?”.
4. Wann und inwiefern darf ich in meiner wissenschaftlichen Arbeit zitieren?
Das Urheberrecht gestattet es ausdrücklich, dass Sie zitieren dürfen, ohne den Rechteinhaber um Erlaubnis zu fragen. Dies gilt auch für Zitate in Internetblogs oder auf Profilseiten. Um das Zitatrecht in Anspruch nehmen zu können, muss immer eine Verbindung zwischen dem eigenen und dem zitierten Werk bestehen.
Jedes Zitat muss einen Zweck erfüllen, die eigenen Ausführungen unterstützen oder der Auseinandersetzung mit dem zitierten Werk dienen. Für die Länge von Zitaten gibt es keine Vorgabe, die Nutzung des zitierten Werkes sollte lediglich durch das Zitat nicht beeinträchtigt werden.
INTERESSANT
Prinzipiell ist es sogar möglich, eine ganze Arbeit zu zitieren, was das Gesetz als Großzitat bezeichnet. Allerdings ist dies nur zur Erläuterung des Inhalts wissenschaftlicher Werke gestattet. Falls die übernommenen Ausschnitte keinen Zitatzweck erfüllen, muss der jeweilige Autor um Erlaubnis gefragt werden.
Zitate aus dem Internet und von der KI
Unbestritten ist mittlerweile, dass Schüler und Studierende bei Haus- und Diplomarbeiten immer öfter abschreiben und das Internet dabei hilft. Hausaufgabenprogramme erleichtern es, fremdes Gedankengut als eigene Leistung auszugeben.
Die Motive dürften sich dabei nur unwesentlich unterscheiden: Es muss schnell gehen, es soll bequem sein, fremde Textstellen und Quellen sollen für Anerkennung sorgen. Selbst für Profis ist immer schwieriger feststellbar, wann ein Plagiat anfängt und wann es aufhört.
Mittlerweile sind nicht nur Google und die Online-Enzyklopädie Wikipedia hoch im Kurs, sondern auch Künstliche Intelligenz. Mittels ChatGPT lassen sich schnell Informationen ausspucken oder sogar ganze Texte schreiben. Das Problem bei diesen Hilfsmitteln ist, dass viele Studenten blind kopieren, die Quellen nicht überprüfen (bei KI, teilweise schwierig) und daher keinerlei Tiefgang in ihren wissenschaftlichen Arbeiten haben.
5. Die Seminararbeit vom Ghostwriter schreiben lassen: Darf ich das?
Schüler und Studierende können sich eine komplette Haus- oder Diplomarbeit auf legalem Weg herunterladen beziehungsweise kaufen. Verschiedene Internetportale bieten bereits fertige Hausarbeiten, teilweise nach Fachbereichen sortiert, zum Kauf an.
Verschiedene Agenturen gehen sogar noch einen Schritt weiter. Sie haben Autoren aus Wissenschaft und Forschung im Repertoire, die Seminararbeiten und andere wissenschaftliche Arbeiten für Studierende schreiben. Diese Form des Ghostwritings ist nicht verboten, allerdings gibt es eine Besonderheit, die Studierende nicht aus dem Auge verlieren sollten:
Studierende, die eine Hausarbeit oder eine Abschlussarbeit einreichen, müssen in der Regel durch ihre Unterschrift bestätigen, dass Sie diese wissenschaftliche Arbeit selbstständig geschrieben haben und alle Textstellen aus fremden Werken als Zitate kenntlich gemacht haben.
Durch diese Unterschrift bestätigen sie, dass sie die Arbeit selbst verfasst haben. Würden Sie die Arbeit eines Ghostwriters dennoch als Ihr eigenes Werk ausgeben, handelt es sich um eine Urheberrechtsverletzung und im Rahmen des Studiums um einen Verstoß gegen die Prüfungsordnung. Exmatrikulation und der Verlust Ihres akademischen Grades sind nur zwei der möglichen Folgen.
6. Achtung Plagiat: Folgen für Studierende
Seit dem Plagiatsskandal von Gutenberg, Koch-Mehrin und Co. sind Studierende und Professoren unglaublich sensibilisiert, wenn sie ihre Hausarbeit anfertigen oder eine solche korrigieren. Jedes Zitat bedeutet höchste Aufmerksamkeit!
Vor allem die Rolle des Internets wird von vielen Beobachtern immer kritischer gesehen. Bei wissenschaftlichen Arbeiten setzen die Studierenden immer mehr auf Informationen und Dokumente aus dem Internet. Die Möglichkeiten sind fast grenzenlos.
Obacht gilt allerdings bei Plagiaten. Aber wann ist ein Zitat kein Zitat mehr, sondern ein Plagiat? Ein Plagiat liegt vor, wenn Sie fremde Gedanken als ihre eigenen ausgeben, indem sie diese nicht als Zitat kennzeichnen. Dabei ist zwischen vier verschiedenen Plagiatsarten zu unterscheiden:
- Komplettplagiat: Komplette Abschnitte werden aus einer Quelle entnommen, ohne diese als Zitat kenntlich zu machen.
- Verschleierung: Textstellen werden aus einer Quelle entnommen, werden aber umformuliert und auch nicht als Zitat kenntlich gemacht.
- Übersetzungsplagiat: Ein fremdsprachiger Text wird Wort für Wort übersetzt und nicht als Zitat kenntlich gemacht. Auch für Übersetzungen gilt: Quelle angeben!
- Strukturplagiat: Hierbei werden keine Textpassagen übernommen, sondern der Aufbau einer anderen Arbeit. Dabei kann es sich beispielsweise um eine Kopie der Gliederung handeln.
Nicht jedes Plagiat ist ein Urheberrechtsverstoß. Oftmals werden nur kurze Textstellen kopiert, die für sich genommen keine ausreichende Schöpfungshöhe haben, um das Urheberrecht zu verletzen. Grundsätzlich kommen aber mehrere Verstöße bei einem Plagiat in Frage:
- unzulässige Verwertung fremder Werke nach §§ 15 ff. UrhG
- unzulässige Abänderung fremder Werke nach § 23 UrhG
- Verletzung des Rechts des Urhebers nach § 13 UrhG
- fehlende Quellenangabe im Falle der erlaubten Übernahme fremder Texte nach § 63 UrhG
ACHTUNG
Ein Plagiat bei einer wissenschaftlichen Arbeit, die Sie als Student im Rahmen eines Studiums an einer Hochschule oder Universität geschrieben haben, hat unabhängig von einer vorhandenen oder nicht vorhandenen Urheberrechtsverletzung andere Konsequenzen. Diese sehen meistens folgendermaßen aus:
- Prüfungsrechtliche Konsequenzen
- Aberkennung des akademischen Grades (bei Abschlussarbeiten wie Bachelor- und Masterarbeit, Dissertation oder Doktorarbeit)
- Exmatrikulation
- Geldstrafe von bis zu 50.000 Euro
7. Fazit
Das Urheberrecht ist in der Wissenschaft und Forschung vor allem zu Lehrzwecken etwas lockerer. 15 Prozent eines geschützten Werkes dürfen Lehrende vervielfältigen und im Unterricht nutzen.
Im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit oder einer Abschlussarbeit dürfen Sie zwar Textzitate aus urheberrechtlich geschützten Werken und fremde Bilder verwenden, müssen allerdings stets die Quelle angeben. Ansonsten geben Sie einen fremden Text als Ihren eigenen aus - dabei handelt es sich um ein Plagiat.
Auch wenn Plagiate nicht immer Urheberrechtsverletzungen darstellen, so stellen sie einen Verstoß gegen die Prüfungsordnung der Hochschule oder Universität dar. Das bedeutet, dass Sie mit Konsequenzen wie Exmatrikulation, Geldstrafe und/oder der Aberkennung Ihres akademischen Grades rechnen müssen.
Da Sie bei einer wissenschaftlichen Arbeit dafür unterschreiben müssen, dass Sie die Arbeit eigenständig verfasst haben, begehen Sie auch einen Verstoß gegen die Prüfungsordnung, wenn Sie einen Ghostwriter für Ihre Arbeit engagieren.
- Zurück zur Übersicht: "Urheberrecht"
- Bilder & Screenshots aus dem Internet
- Adobe-Echtheitssiegel für Bilder
- Videos
- Texte
- Musik
- Filme
- Pläne und Zeichnungen
- Software
- Datenbanken
Alles, was Sie wissen müssen