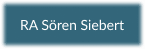Worum geht's?
Bis 2017 galt für Urheberrechtsverletzungen im Internet die sogenannte Störerhaftung. Anschlussinhaber konnten für Rechtsverletzungen haftbar gemacht werden. Trotz der Gesetzesänderung ist die Haftung von Anschlussinhabern nicht per se ausgeschlossen. Wann Sie als Anschlussinhaber eines WLAN-Netzwerkes dennoch für Rechtsverletzungen haftbar gemacht werden können und welche Vorkehrungen Sie treffen sollten, damit Sie keine teuren Abmahnungen kassieren, lesen Sie in unserem Ratgeber.
1. Was ist die sogenannte Störerhaftung?
Die Störerhaftung besagt, dass eine Person für Rechtsverstöße verantwortlich gemacht werden kann, obwohl sie die Tat nicht selbst begangen hat. Die Störerhaftung spielt vor allem im Markenrecht, Urheberrecht sowie im Kennzeichen- und Verwertungsrecht eine Rolle. § 1004 BGB regelt den Eigentumsschutz und spricht dem Eigentümer einen Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch gegenüber dem sogenannten “Störer” zu.
WUSSTEN SIE’S SCHON?
Gestört werden im Falle des Urheberrechts die Rechte der Urheber. Der Rechteinhaber kann eine Plattenfirma, Fotoagentur oder eine Filmproduktionsgesellschaft sein. Nur der Urheber kann Nutzungsrechte für sein Werk veräußern.
Teilt eine Person die urheberrechtlich geschützten Inhalte beispielsweise über Internet-Tauschbörsen mit anderen Nutzern, ohne dass er die Genehmigung des Urhebers dafür hat, kann er als Täter dafür zur Verantwortung gezogen werden. Hier spielt es auch keine Rolle, ob der Störer die Inhalte wissentlich oder unwissentlich rechtswidrig geteilt hat.
Einige Jahre wurde die Störerhaftung in Deutschland dazu genutzt, Besitzer eines Internetanschlusses anhand ihrer IP-Adresse für illegale Aktivitäten wie Filesharing in Tauschbörsen oder über Peer-to-Peer-Netzwerke zur Verantwortung zu ziehen. Dies hat sich allerdings seit 2017 gewandelt.
2. Der rechtliche Hintergrund der Störerhaftung
Bis 2017 hat sich die Störerhaftung als Allzweckwaffe bei der Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen im Internet etabliert. Personen, die durch illegales Filesharing Urheberrechtsverletzungen begangen haben, sollten durch die Störerhaftung indirekt haftbar gemacht werden.
Bei einem Internetanschluss, der von mehreren Personen genutzt wird, wie es beispielsweise in WGs, Familien oder in öffentlichen Cafés der Fall ist, ist oft allerdings unklar, wer die Rechtsverletzung tatsächlich begangen hat. Somit wurde oftmals auf die sogenannte Störerhaftung ausgewichen.
WAS IST DIE MITSTÖRERHAFTUNG?
Eine Person, die urheberrechtlich geschützte Werke wie Filme, Bilder oder Musik ins Internet stellt oder sie in Tauschbörsen zum Download anbietet, wird Täter genannt. Da dieser bei mehreren Nutzern eines Internetanschlusses nicht immer eindeutig ermittelt werden kann, wird versucht, den Inhaber des Internetanschlusses - den Mitstörer - haftbar zu machen.
Hier war vor allem das Ziel, jemanden rechtlich zur Verantwortung zu ziehen. Oftmals musste der Mitstörer vor Gericht glaubhaft darlegen und beweisen, dass er nicht verantwortlich ist und entsprechende Vorkehrungen getroffen hat. Hierzu zählt beispielsweise ein passwortgeschütztes WLAN oder eine verschlüsselte Verbindung zwischen Router und PC.
Für Anschlussinhaber bedeutete die Störerhaftung oft rechtliche Unsicherheiten, Probleme und im Falle einer Abmahnung hohe Kosten. Aus diesem Grund stand die Störerhaftung lange Zeit in der Kritik.
3. Störerhaftung heute: Wie ist die Rechtslage?
Im Oktober 2017 wurde die Störerhaftung für Internetzugangsanbieter im Rahmen einer Gesetzesänderung abgeschafft. Anwaltskanzleien können seitdem keine Abmahnkosten aus Filesharing-Abmahnungen mehr geltend machen, wenn diese mit der Störerhaftung in Zusammenhang stehen.
Die Gesetzesnovelle machte zudem den Weg für offene WLAN-Hotspots in Deutschland frei. WLAN-Betreiber, wie Cafés oder Restaurants, müssen ihre Netzwerke nicht mehr verschlüsseln oder Nutzer zur Registrierung auffordern. Dies bietet eine gewisse Rechtssicherheit für Anschlussinhaber.
ACHTUNG
Damit die Rechteinhaber allerdings weiterhin geschützt werden, können sie bei Urheberrechtsverletzungen im Einzelfall Nutzungssperren erwirken. So kann eine erneute Rechtsverletzung verhindert werden. Die Sperrung muss allerdings die letzte Instanz bleiben und gleichzeitig zumutbar und verhältnismäßig sein.
4. Handlungsschritte für Anschlussinhaber: Was müssen Sie tun?
Auch wenn die Störerhaftung in Deutschland weitestgehend abgeschafft wurde und Anschlussinhaber nicht mehr ohne Weiteres haftbar gemacht werden können, können sie dennoch zur Verantwortung gezogen werden. Im Falle einer Urheberrechtsverletzung über Ihr Netzwerk können Sie sich auf das sogenannte Haftungsprivileg berufen. Hierzu müssen Sie belegen können, dass andere Internetnutzer Zugang zu Ihrem WLAN hatten. Dies ist beispielsweise durch die Dokumentation der Routereinstellungen oder Routerprotokolle möglich.
Die bloße Behauptung, dass Sie ein offenes WLAN betreiben und auch Dritte dieses nutzen können, reicht nicht aus, um sich auf das Haftungsprivileg zu berufen.
Das Landgericht Köln hat in diesem Zusammenhang am 23. September 2021 ein Urteil (Az. 14 S 10/20) gefällt. Das Gericht macht deutlich, dass es auch im privaten Rahmen nicht ausreicht, wenn der Anschlussinhaber behauptet, dass das Netzwerk auch von anderen im Haushalt lebenden Personen genutzt wird. Trägt der Anschlussinhaber im Rahmen der sekundären Darlegungslast ungenügend vor, haftet er selbst für Rechtsverstöße.
Private Anschlussinhaber sollten daher auch weiterhin auf ein passwortgeschütztes Netzwerk achten. Eine erhöhte Sicherheit ist durch die WPA3-Verschlüsselung gegeben. Diese setzt moderner Verschlüsselungsmethoden ein und bietet zusammen mit einem starken Passwort hohen Schutz. Für Gäste bietet sich ein Gastzugang an.
5. Abmahnung erhalten? Das sollten Sie jetzt beachten
Treffen Sie als Anschlussinhaber - egal ob privat oder gewerblich - keine Sicherheitsvorkehrungen für das Netzwerk und dokumentieren Sie die Nutzer Ihres Anschlusses nicht, können Sie trotz Abschaffung der Störerhaftung auf Unterlassung in Anspruch genommen werden.
Wurde eine Urheberrechtsverletzung festgestellt, erhalten Sie als Anschlussinhaber eine Abmahnung - auch wenn Sie die Rechtsverletzung nicht selbst verursacht haben.
ACHTUNG
Ignorieren Sie die Abmahnung nicht! Bei Filesharing-Abmahnungen haben Sie in der Regel nur kurze Fristen, um auf die Abmahnung zu reagieren. Legen Sie in einer Stellungnahme dar, dass Sie zwar der Anschlussinhaber sind, von der Urheberrechtsverletzung allerdings keine Kenntnis hatten und der Zugang zum Netzwerk offen ist. Bestenfalls legen Sie das Routerprotokoll bei, welches dies beweist.
Sind Sie sich unsicher, wie Sie auf eine Filesharing-Abmahnung reagieren sollten, kontaktieren Sie im Zweifelsfall immer einen Anwalt. Unterschreiben Sie nicht ungeprüft eine beiliegende Unterlassungserklärung und zahlen Sie zunächst keine Abmahnkosten, die aus dem Schreiben hervorgehen.
6. Fazit zur Störerhaftung
Die Gesetzesänderung im Oktober 2017 schaffte die Störerhaftung in Deutschland weitestgehend ab. Die Regelungen, die zunächst im Telemediengesetz (TMG) verankert waren, finden sich im Digitale-Dienste-Gesetz und auch im Digital Service Act wieder.
Anschlussinhaber von WLAN-Netzen können laut aktueller Rechtsprechung allerdings für Rechtsverletzungen haftbar gemacht werden. Dies ist dann der Fall, wenn Sie nicht nachweisen können, dass Dritte den Anschluss genutzt haben und Sie selbst nicht als Täter infrage kommen. Daher sollten Sie als WLAN-Anbieter Routerprotokolle speichern oder über die Routereinstellungen dokumentieren, wer wann Zugriff auf das Netzwerk hatte.
Nur so können Sie im Falle einer Abmahnung darlegen, dass Sie die Verletzung des Urheberrechts nicht selbst begangen haben. Ignorieren Sie Abmahnungen nicht, sondern reagieren Sie darauf. Im Zweifelsfall hilft Ihnen ein Anwalt für Internetrecht.
- Zurück zur Übersicht: "Urheberrecht"
- Filesharing
- Filesharing-Abmahnung
- Verjährung einer Filesharing-Abmahnung
- Ist Filme streamen illegal?
- Tauschbörsen
- Unterlassungserklärung
- modifizierte Unterlassungserklärung
Alles, was Sie wissen müssen