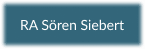Worum geht's?
Das Online-Shopping hat sich in den letzten Jahren zu einer bedeutenden Form des Konsums entwickelt und bringt sowohl für Käufer als auch für Verkäufer eine Vielzahl von Rechten und Pflichten mit sich. In diesem Zusammenhang ist es entscheidend, die grundlegenden Regeln und Verantwortlichkeiten zu verstehen, um weiterhin mit Freude einzukaufen und zu verkaufen. Teil dieser Verantwortlichkeiten sind sichere Zahlungsmethoden, Gewährleistung und Garantie sowie die Lieferung von qualitativ hochwertigen Produkten. Doch nicht nur herkömmliche Online-Käufe sind relevant, sondern auch Online-Auktionen, bei denen spezielle Aspekte des Kaufprozesses und der Verantwortlichkeit eine Rolle spielen.
1. Die Evolution des Einkaufsverhaltens: Online-Shopping heute
In den letzten Jahrzehnten hat sich das Einkaufsverhalten drastisch verändert. Waren werden heutzutage vielfach nicht mehr vor Ort ausgesucht und gekauft, denn Verbraucher können Produkte und Dienstleistungen aus der ganzen Welt bequem von ihren eigenen Geräten aus erwerben. Sind Verkäufer und Käufer zufrieden, sind Gewährleistungsrechte, Zahlungsverzug oder Minderung nicht von Bedeutung. Aber was ist, wenn ein mangelhaftes Produkt geliefert wird oder der Käufer nicht zahlt? Welche Rechte und Pflichten Sie als Käufer oder Verkäufer haben, erfahren Sie im folgenden Artikel.
2. Rechte und Pflichten des Käufers
Jeder von uns kennt die Situation nur allzu gut: Man hat sich sorgfältig auf den Weihnachtseinkauf oder einen Geburtstag vorbereitet, ein Geschenk mit Liebe ausgesucht und es mit freudiger Erwartung überreicht. Doch dann die Enttäuschung – das Geschenk gefällt dem Empfänger nicht. In solchen Momenten stellen sich viele von uns die Frage, was mit dem ungeliebten Präsent geschehen soll. Doch welche Rechte haben Käufer in solchen Fällen eigentlich? Und was ist, wenn das Geschenk gefällt, aber es beschädigt ist oder nicht einwandfrei funktioniert.
An dieser Stelle müssen die Rechte des Käufers bei Mängeln klar abgegrenzt werden von den Rechten des Käufers bei mangelfreier Ware. Sie denken nun an Umtausch- und Rückgaberechte? Hier muss ganz klar unterschieden werden zwischen einem Einkauf im stationären Handel oder im Online Handel. Aus Kulanz wird Kunden im stationären Handel oftmals ein Rückgabe- oder Umtauschrecht bei einwandfreien Waren eingeräumt, die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs sehen einen Anspruch hierauf aber nicht vor.
AUFGEPASST
Bei mangelfreien Waren steht Ihnen im stationären Handel kein Anspruch auf Umtausch- oder Rückgabe der Waren zu. Anders sieht es aus, wenn Ihnen aus Kulanz ein Rückgabe- oder Umtauschrecht eingeräumt wird. Dies kann jedoch an bestimmte Bedingungen geknüpft werden.
Im Online Handel findet sich ein Rückgaberecht für einwandfreie Waren im Fernabsatzrecht. Da Sie, anders als im stationären Handel, die Waren nicht vor Ort begutachten und prüfen können, wird Ihnen ein Widerrufsrecht eingeräumt. Dieses ermöglicht Ihnen die Lösung vom Vertrag ohne Angabe von Gründen innerhalb von 14 Tagen.
PRAXIS-TIPP
Als Verkäufer müssen Sie Ihre Kunden auf das Widerrufsrecht hinweisen. Soll Ihr Kunde die Rücksendekosten tragen, müssen Sie ihn vor Vertragsabschluss rechtzeitig darauf hinweisen. Tun Sie dies nicht, müssen Sie die Kosten tragen.
Rechte des Käufers bei Mängeln
Sie haben eine Ware online bestellt und diese weist Beschädigungen auf oder funktioniert nicht? Das im BGB geregelte Kaufvertragsrecht sieht für Käufer und Verkäufer im Online Handel dieselbe Gewährleistung, auch Mängelhaftung genannt, vor wie im stationären Handel. Voraussetzung ist zunächst, dass der Kaufgegenstand mangelhaft ist. Mängel können den Zustand der Sache wie optische Schäden oder die Beeinträchtigung der Funktion betreffen. Diese werden dann als Sachmängel bezeichnet.
Mehr Informationen zu den verschiedenen Mängeln und ihren Voraussetzungen haben wir Ihnen in unserem Artikel „Sachmängel: Wann müssen Händler Ware zurücknehmen?”zusammengestellt.
Der Mangel muss in dem Zeitpunkt der Übergabe der Ware an den Verbraucher vorgelegen haben. Zugunsten des Käufers wird nach den Vorschriften des Kaufrechts vermutet, dass der Mangel schon bei Übergabe an den Käufer vorlag, wenn sich der Mangel innerhalb eines Jahres zeigt. Dies wird als Beweislastumkehr bezeichnet. Zeigt sich der Mangel erst nach einem Jahr, muss der Käufer beweisen, dass der Mangel schon bei Übergabe vorlag.
Lag ein Mangel im Zeitpunkt der Übergabe vor, kann der Käufer von seinem Gewährleistungsrecht Gebrauch machen. Zu den Gewährleistungsrechten zählen Nacherfüllung, Minderung, Rücktritt und Schadensersatz. Der Käufer kann jedoch zunächst nicht frei zwischen diesen Rechten wählen, da die Nacherfüllung (Nachbesserung oder Ersatzlieferung) im Kaufrecht gegenüber den anderen Rechten vorrangig ist.
Der Vorrang der Nacherfüllung wird auch als Recht zur zweiten Andienung bezeichnet. Sie als Käufer können dabei zwischen Reparatur und Neulieferung der Kaufsache wählen. Ihnen als Verkäufer gibt die Nacherfüllung die Möglichkeit, Ihre Pflicht zur Lieferung einer mangelfreien Sache doch noch zu erfüllen.
Das Verbraucherrecht sieht für den Käufer als Verbraucher Erleichterungen vor, wie zum Beispiel die Entbehrlichkeit einer Fristsetzung zur Nacherfüllung, wenn eine angemessene Frist abgelaufen ist. Ist die Nacherfüllung nicht erfolgt oder fehlgeschlagen, kann der Käufer von seinem Recht auf Minderung des Kaufpreises, dem Recht auf Rücktritt vom Kaufvertrag oder auf Schadensersatz Gebrauch machen. Die Gewährleistungsfrist meint die Verjährung der genannten Rechte und beträgt regelmäßig zwei Jahre.
Die Mängelhaftung ist von der Garantie abzugrenzen. Während die Mängelhaftung gesetzlich garantiert ist, handelt es sich bei der Garantie um eine freiwillige Leistung des Herstellers oder selten des Händlers. Mehr Informationen zur Abgrenzung von Garantie und Gewährleistung finden Sie in unserem Artikel „Garantie, Gewährleistung und Produkthaftung: Wo ist der Unterschied”.
Rechte des Käufers bei Sachmängeln digitaler Produkte
Beim Online-Shopping können heutzutage nicht mehr nur materielle Güter, sondern auch Software, Apps und E-Books erworben werden.
Doch was passiert, wenn diese digitalen Produkte nicht wie erwartet funktionieren und Mängel aufweisen?
Ein Mangel bei digitalen Produkten kann vielfältige Formen annehmen: Die Software stürzt wiederholt ab, ein E-Book weist Fehler im Text auf, ein Online-Spiel hat Serverprobleme oder ein Videostreaming-Dienst bietet nicht die versprochene Qualität. Auch hier muss zunächst ein Mangel am Produkt im maßgeblichen Zeitpunkt vorliegen. Eignet sich das Produkt nicht für die gewöhnliche Verwendung oder werden Zubehör und Anleitungen, die der Verbraucher erwarten kann, nicht mitgeliefert, ist das digitale Produkt mangelhaft. Zu den Pflichten des Verkäufers gehört auch die Aktualisierungspflicht. Läuft der Vertrag über einen längeren Zeitraum, müssen auch fortlaufend Aktualisierungen bereitgestellt und der Verbraucher über diese informiert werden.
WICHTIG
Auch bei einmaliger Bereitstellung besteht eine Aktualisierungspflicht gegenüber dem Verbraucher. Wie lange Aktualisierungen zur Verfügung gestellt werden müssen, bestimmt sich nach Art und Zweck der digitalen Produkte sowie der Erwartung des Verbrauchers.
Ist das digitale Produkt mangelhaft, stehen dem Verbraucher dieselben Gewährleistungsrechte wie im Kaufvertragsrecht zu. Auch hier kann folglich Nacherfüllung verlangt, der Preis gemindert oder vom Vertrag zurückgetreten werden.
Wie im Kaufvertragsrecht sehen die Regelungen zu den Verbraucherverträgen über digitale Produkte auch Erleichterungen für den Verbraucher vor. Zeigt sich ein Mangel innerhalb eines Jahres nach einmaliger Bereitstellung oder zeigt sich bei einem dauerhaft bereitgestellten digitalen Produkt ein Mangel im Bereitstellungszeitraum, so wird vermutet, dass das digitale Produkt bei der Bereitstellung mangelhaft war.
Ansprüche bei Mängeln verjähren grundsätzlich in zwei Jahren, spezielle Regelungen bestehen für die Verjährung von Ansprüchen bei dauerhafter Bereitstellung und bei Verletzung von Aktualisierungspflichten.
Pflichten des Käufers
Aus dem Kaufvertrag ergeben sich auch Pflichten für den Käufer. Dieser hat den vereinbarten Kaufpreis zu zahlen und die gekaufte Sache abzunehmen ( § 433 BGB).
3. Rechte und Pflichten des Verkäufers
Während der Verkäufer von seinem Vertragspartner rechtzeitige Abnahme und Bezahlung der Ware verlangen kann, ist es für den Verkäufer mit der bloßen Lieferung und Übereignung mangelfreier Ware noch nicht getan.
Wichtig zu wissen: Sie als Verkäufer treffen zahlreiche Informationspflichten.
Kommen Sie diesen Pflichten nicht nach, entstehen hieraus Vor- und Nachteile für beide Vertragsparteien.
Beispiel: Informieren Sie als Verkäufer von digitalen Produkten den Verbraucher nicht über die Verfügbarkeit von Aktualisierungen und die Folgen einer unterlassenen Installation, so haften Sie als Unternehmer für Mängel, die auf das Fehlen einer Aktualisierung zurückzuführen sind.
Im Fernabsatzrecht haben Sie als Verkäufer den Verbraucher über sein Widerrufsrecht zu informieren. Tun Sie dies nicht, beginnt die Widerrufsfrist nicht zu laufen.
LESE-TIPP
Weitere Informationen zum Thema Informationspflichten von Verkäufern finden Sie in unserem Artikel “Online-Shop rechtssicher gestalten”.
Sachmangelrisiko als Verkäufer reduzieren
Um als Verkäufer rechtssicher zu handeln und Ansprüche aus dem Gewährleistungsrecht zu vermeiden, sollten Sie Waren stets in einwandfreiem Zustand liefern. Daneben sollten Sie sämtlichen Informationspflichten nachkommen. Neben den Pflichtinformationen zum Widerrufsrecht und sachgemäßen Installationsanleitungen und Gebrauchsanweisungen sollten Ihre AGB individuell auf Ihre Tätigkeit angepasst sein. Auch Ihr Online-Shop unterliegt rechtlichen Vorgaben, wie beispielsweise der Impressumspflicht. Und wie sieht es mit einer DSGVO-konformen Datenschutzerklärung auf Ihrer Website aus? Haben Sie hiervon noch nicht gehört, sollten Sie spätestens jetzt aktiv werden.
Websitecheck und Rechtstexte mit eRecht24 Tools
- Prüfen Sie Ihre Website mit dem Scanner
- Sichern Sie Ihre Website mit geprüften Rechtstexten
- Testen Sie die Barrierefreiheit Ihrer Website
Kann ich als Verkäufer die Rechte des Käufers beschränken oder ausschließen?
Sind Sie als Verkäufer im B2C Bereich tätig, verkaufen also Waren an Verbraucher, können Sie die Gewährleistungsrechte nicht vollständig ausschließen. Allerdings können Sie Ansprüche auf Schadensersatz ausschließen, sowie die Gewährleistungsfrist für gebrauchte Waren verkürzen. Im Verhältnis von Verbrauchern untereinander oder unter Unternehmern sind weitergehende Ausschlüsse möglich.
Hierbei ist jedoch Vorsicht geboten: Sätze wie „Jegliche Gewährleistung wird ausgeschlossen” oder „1 Jahr Gewährleistung” sind rechtlich problematisch. Haftungsansprüche wegen Verletzung des Körpers oder der Gesundheit durch vorsätzliche oder fahrlässige Pflichtverletzung dürfen niemals ausgeschlossen werden und auch eine Verkürzung der Gewährleistungsfrist kann zur Unwirksamkeit der AGB führen. Möchten Sie Ihre Haftung vertraglich oder per AGB begrenzen, sollten Sie sich Unterstützung holen. Wir von eRecht24 stehen Ihnen mit zahlreichen Tools und Generatoren zur Seite und helfen Ihnen, Ihren Online-Shop rechtssicher zu gestalten.
4. Besonderheiten bei Online Auktionen im Überblick
Aber wie sieht es mit Ihren Rechten und Pflichten aus, wenn Sie als Verkäufer an Online Auktionen teilnehmen oder dort als Käufer einkaufen? Kurz gesagt: Auch bei Online-Auktionen haben Sie die oben beschriebenen Gewährleistungsrechte und -pflichten. Hat die ersteigerte Ware einen Mangel, können Sie auch bei Online Auktionen Nachbesserung verlangen. Ist eine Reparatur nicht möglich, können Sie den Preis mindern oder vom Vertrag zurücktreten. Zu beachten ist hier, dass eine Verkürzung der Gewährleistungsfrist per AGB auch hier möglich ist. Handelt es sich um einen Verkauf im C2C Bereich, kann die Mängelgewährleistung auch vollständig ausgeschlossen werden.
Regelmäßig kommt der Kaufvertrag zwischen Ihnen als Käufer und dem Anbieter der Ware zustande, der Betreiber der Auktionsplattform bietet nur den Raum dafür.
Anders als in einem Auktionshaus ist für das Zustandekommen des Vertrages bei Online Auktionen regelmäßig nicht der Zuschlag des Auktionators ausschlaggebend, sondern das Einstellen der Ware als Angebot und das Höchstgebot als Annahme. Handelt es sich bei der Online Auktion um eine echte Versteigerung, kommt es auf den Zuschlag an.
Vertippen Sie sich bei Eingabe Ihres Angebotes, greifen die Irrtumsvorschriften des BGB und Ihre abgegebene Erklärung kann von Ihnen angefochten werden. Entsteht dem Anbieter ein Schaden dadurch, dass er auf Ihre Erklärung vertraut hat, müssen Sie den Schaden ersetzen.
Haben Sie bei Online-Auktionen ein Widerrufsrecht? Handelt es sich um eine echte Versteigerung mit Zuschlag, finden die Regelungen des Fernabsatzrechts keine Anwendung. Bei gewöhnlichen Online-Auktionen wie auf ebay besteht ein Widerrufsrecht, wenn es sich um einen Vertrag zwischen Unternehmer und Verbraucher handelt. Handeln beide Parteien für private Zwecke oder sind beide Vertragspartner gewerblich tätig, kann ein Vertrag nicht widerrufen werden.
Sind Sie also als gewerblicher Verkäufer auf Auktionsplattformen wie ebay tätig, sollten Sie darauf achten, Ihre Kunden über Ihr Widerrufsrecht zu belehren und das entsprechende Widerrufsformular zur Verfügung zu stellen. Ansonsten beginnt die Widerrufsfrist, die 14 Tage beträgt, gar nicht erst zu laufen.
- Zurück zur Übersicht: "E-Commerce"
- Vertragsschluss im Internet
- Verpackungsgesetz
- Plattformen-Steuertransparenzgesetz (PStTG)
- Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
- Altersüberprüfung
- Altersverifikationssysteme
- Informationspflichten
- CE-Kennzeichnungspflicht
- Produktsicherheitsverordnung
Alles, was Sie wissen müssen